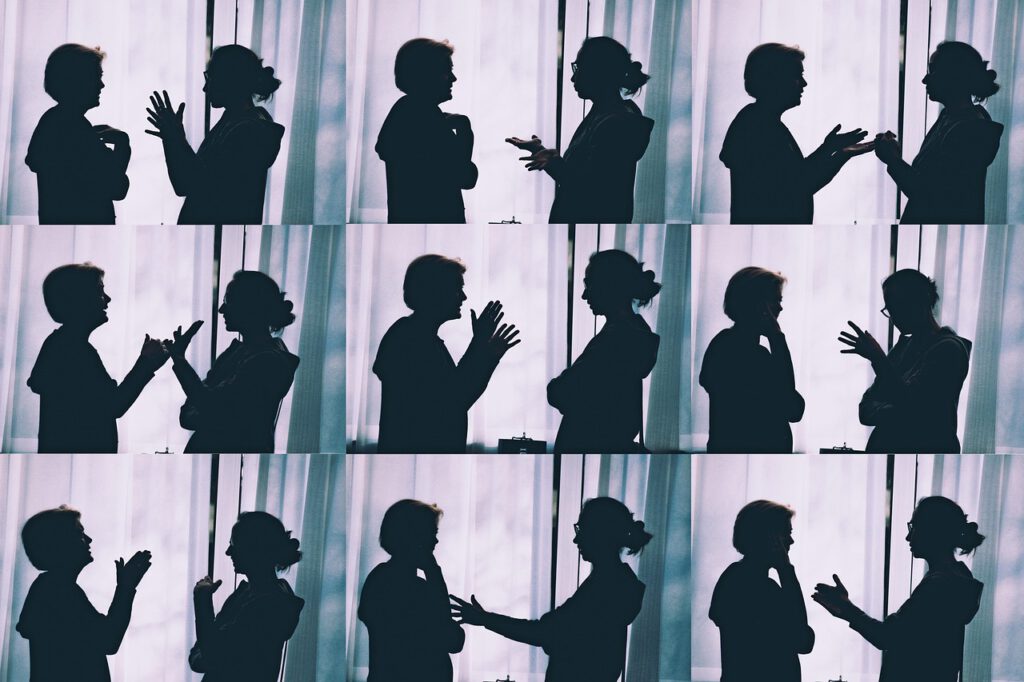Stell Dir vor, Du sitzt in einer hitzigen Diskussion, in der Emotionen hochkochen und Fakten manchmal untergehen – kennst Du das Gefühl? In unserem Alltag begegnen wir immer wieder Menschen, die mit populistischen Aussagen, verzerrten Argumenten und manipulativen Taktiken versuchen, uns von ihrer Meinung zu überzeugen. Als jemand, der schon viele Jahre Erfahrung damit hat, wie man sich gegen Rechtspopulismus und destruktive Diskussionskultur behauptet, möchte ich Dir in diesem Artikel zeigen, wie Du Dich mit den richtigen rhetorischen Techniken und Strategien behaupten kannst.
Zusammenfassung
- Klare Argumentationsstrategien helfen, Populismus effektiv zu entkräften.
- Der Umgang mit Whataboutism und persönlichen Angriffen erfordert Ruhe und Sachlichkeit.
- Fundierte Fakten machen es schwer, Fake News und Verschwörungstheorien standzuhalten.
- Die Balance zwischen Fakten, Emotionen und persönlicher Haltung ist entscheidend.
- Es gibt konkrete Methoden, um destruktive Diskussionen souverän zu beenden.
Einleitung
In diesem Beitrag erfährst Du, wie Du klare Argumentationslinien gegen populistische Rhetorik aufbaust, welche Strategien Dir im Umgang mit Whataboutism und persönlichen Angriffen helfen und wie Du Fake News sowie Verschwörungstheorien effektiv entkräftest. Dabei legen wir besonderen Wert auf den geschickten Einsatz von Fakten, Emotionen und einer authentischen Haltung. Außerdem zeige ich Dir, wie Du Diskussionen beendest, wenn sie destruktiv werden und Dein Selbstbewusstsein dabei bewahrst.
Der Artikel richtet sich an Dich, wenn Du Dich in hitzigen Debatten nicht verunsichern lassen möchtest und Dir gleichzeitig praktische Tipps an die Hand geben möchtest, um auch in emotional aufgeladenen Gesprächen einen kühlen Kopf zu bewahren. Wir tauchen ein in die Welt der rhetorischen Techniken und Strategien, die Dir helfen, Deine Sichtweise überzeugend darzulegen und gleichzeitig offen für konstruktiven Dialog zu bleiben. Also, lass uns gemeinsam herausfinden, wie Du mit fundierten Argumenten und einer gesunden Portion Empathie und Selbstbewusstsein jeden Diskussionsgegner in Schach halten kannst.
Die wichtigsten Argumentationstechniken gegen Populismus
Populismus lebt von einfachen Slogans und emotional aufgeladenen Parolen, die oft komplexe Sachverhalte verzerren. Eine der effektivsten Strategien gegen diesen Simplifizierungsdrang ist es, auf fundierte und gut recherchierte Fakten zu setzen. Dabei ist es wichtig, nicht nur auf die offensichtlichen Argumente zu antworten, sondern auch Hintergründe zu beleuchten und den Diskussionspartner auf eine sachliche Ebene zurückzuführen.
Zunächst solltest Du Dir immer im Vorfeld überlegen, welche Fakten Deine Argumentation untermauern. Es reicht nicht, nur pauschale Aussagen zu machen – zeige konkrete Zahlen, Statistiken und Beispiele, die Deine Sichtweise stützen. Wenn Du beispielsweise in einer Diskussion über Migration argumentierst, kannst Du auf offizielle Berichte, Studien oder Daten von anerkannten Institutionen verweisen. So nimmst Du dem Populisten die emotionale Überhöhung und stellst klar, dass seine Aussagen oft auf simplifizierten oder verzerrten Informationen beruhen.
Ein weiterer zentraler Punkt ist es, den Populismus als ein Werkzeug zu entlarven, das auf Spaltung und Angst basiert. Häufig werden in populistischen Debatten Themen überzogen dramatisiert, um Emotionen zu schüren. Hier hilft es, mit Ruhe und Empathie zu reagieren: Erkenne die Emotionen an, ohne sie zu übernehmen, und lenke das Gespräch auf rationale Argumente. Frage Dich: „Was steckt wirklich hinter dieser Aussage?“ Oft entdeckst Du so, dass hinter dem populistischen Slogan komplexe Zusammenhänge verborgen sind, die in einer einfachen Aussage nicht dargestellt werden können.
Ein praktisches Beispiel: In Diskussionen über Sicherheitspolitik greifen Populisten oft auf vereinfachte Thesen zurück, die suggerieren, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen eine Gefahr darstellen. Hier ist es hilfreich, auf empirische Studien hinzuweisen, die belegen, dass Kriminalitätsraten nicht pauschal an Nationalität oder Religion gekoppelt sind. Zeige, wie differenziert die Realität ist, und fordere Deinen Gegenüber auf, ebenfalls differenzierter zu argumentieren.
Außerdem ist es wichtig, rhetorische Fragen einzusetzen, die zum Nachdenken anregen. Frage: „Hast Du schon einmal darüber nachgedacht, wie viel komplexer unsere Gesellschaft ist, als es dieser einfache Slogan vermuten lässt?“ Solche Fragen öffnen den Diskurs und machen es dem Gegenüber schwer, pauschale Aussagen weiterhin zu vertreten.
Auch das „Spiegeln“ der Argumente kann sehr effektiv sein: Wiederhole in eigenen Worten die Aussagen Deines Diskussionspartners und frage dann, ob er die Komplexität der Realität anerkennen kann. Dies führt oft dazu, dass Populisten in ihrer eigenen Argumentation gefangen werden, da sie plötzlich sehen, dass ihre Aussagen nicht die gesamte Wahrheit abbilden. Indem Du immer wieder auf die Vielschichtigkeit der Themen hinweist, bringst Du den Diskussionsverlauf in eine konstruktive Richtung.
Zu guter Letzt solltest Du nicht zögern, auch mal persönliche Erfahrungen oder Anekdoten einzubringen. Geschichten berühren und bleiben im Gedächtnis – sie schaffen eine Verbindung zwischen abstrakten Fakten und der gelebten Realität. Wenn Du beispielsweise von einer persönlichen Begegnung erzählst, bei der Vorurteile abgebaut werden konnten, verleihst Du Deiner Argumentation zusätzliches Gewicht.
Zusammengefasst: Mit einer Mischung aus fundierten Fakten, differenzierten Argumenten und der Kunst, Emotionen anzuerkennen ohne sie zu übernehmen, kannst Du populistischen Argumenten effektiv entgegentreten und den Diskurs wieder auf eine sachliche Ebene lenken.
Umgang mit Whataboutism, Verdrehungen und persönlichen Angriffen
Es ist kaum zu übersehen: In vielen hitzigen Diskussionen taucht das Phänomen des Whataboutism auf. Dabei wird versucht, die Diskussion vom eigentlichen Thema abzulenken, indem auf vermeintliche Fehlverhalten an anderer Stelle hingewiesen wird. Häufig gehen diese Techniken Hand in Hand mit Verdrehungen und persönlichen Angriffen, die mehr der Provokation als einer sachlichen Debatte dienen.
Der erste Schritt im Umgang mit solchen Taktiken ist es, die Ablenkungsmanöver klar zu benennen. Wenn Dein Gegenüber plötzlich mit „Aber was ist mit…?“ reagiert, ist es wichtig, ruhig zu bleiben und darauf hinzuweisen, dass dies vom ursprünglichen Thema ablenkt. Du kannst zum Beispiel sagen: „Das ist ein interessanter Punkt, aber lass uns erst einmal beim aktuellen Thema bleiben.“ Dadurch signalisierst Du, dass Du nicht bereit bist, in eine Debatte über Nebenfragen abzurutschen.
Ein weiterer hilfreicher Ansatz ist es, gezielt nach den zugrundeliegenden Argumenten zu fragen. Frag: „Wie passt das zu dem, was wir gerade diskutieren?“ oder „Kannst Du genauer erklären, wie das mit unserem Thema zusammenhängt?“ Solche Fragen zwingen Deinen Diskussionspartner dazu, seine Argumentation zu konkretisieren und machen die Manipulation durch Verdrehungen transparenter.
Oftmals werden in solchen Situationen auch persönliche Angriffe losgelassen, die Dich emotional treffen können. Hier gilt: Lass Dich nicht provozieren! Atme tief durch und erinnere Dich daran, dass persönliche Angriffe oft ein Zeichen für Unsicherheit oder einen Mangel an inhaltlichen Argumenten sind. Eine gute Strategie ist es, nicht auf die emotionale Ebene einzugehen, sondern sachlich zu bleiben: „Ich merke, dass Du sehr emotional reagierst. Lass uns bitte wieder auf die Fakten konzentrieren.“ Dies schafft Raum für eine konstruktive Diskussion und lenkt den Fokus wieder auf das Wesentliche.
Ein praktisches Beispiel aus dem Alltag: Stell Dir vor, in einer Diskussion über Umweltschutz wirft Dir jemand vor, dass Du selbst nicht umweltbewusst lebst. Anstatt defensiv zu reagieren, kannst Du die Frage umkehren: „Interessant, dass Du das sagst. Wie definierst Du denn umweltbewusstes Leben, und inwiefern passt das zu meinen Handlungen?“ So lenkst Du den Fokus auf eine sachliche Klärung und vermeidest, dass die Diskussion in eine persönliche Attacke abdriftet.
Zudem ist es hilfreich, immer wieder kurz innezuhalten und sich zu fragen: „Was will mein Gegenüber wirklich erreichen?“ Häufig steckt hinter dem Whataboutism der Versuch, Kritik zu unterminieren oder eigene Schwächen zu verschleiern. Indem Du diese Taktik erkennst, kannst Du gezielt dagegen steuern und die Diskussion auf die inhaltlichen Kernfragen zurückführen.
Manchmal hilft es auch, bewusst eine Pause einzulegen, wenn die Angriffe zu persönlich werden. Ein einfacher Satz wie „Ich merke, dass wir beide emotional werden. Vielleicht sollten wir einen Moment durchatmen und uns auf die wesentlichen Fakten konzentrieren“ kann Wunder wirken. Diese Methode signalisiert, dass Du bereit bist, die Diskussion fortzusetzen, aber unter fairen und sachlichen Bedingungen.
Schließlich solltest Du auch Deine eigene Körpersprache und Tonalität im Auge behalten. Oft kann schon ein ruhiger, gelassener Tonfall dazu beitragen, dass sich die Situation entspannt. Zeige, dass Du offen für Diskussionen bist, aber klare Grenzen setzt, wenn es um persönliche Angriffe geht. Auf diese Weise stärkst Du nicht nur Deine Position, sondern setzt auch ein Zeichen gegen destruktive Kommunikationsmuster.
Zusammengefasst: Der Schlüssel im Umgang mit Whataboutism, Verdrehungen und persönlichen Angriffen liegt darin, klar und sachlich zu bleiben, die Ablenkungsmanöver zu benennen und den Fokus immer wieder auf das eigentliche Thema zu lenken. So schaffst Du eine Gesprächsatmosphäre, in der auch kritische Themen fair und fundiert diskutiert werden können.
Wie man Fake News und Verschwörungstheorien entkräftet
In Zeiten von Social Media und ständiger Informationsflut ist es gar nicht so überraschend, dass Fake News und Verschwörungstheorien einen festen Platz in vielen Diskussionen eingenommen haben. Doch wie kannst Du diesen Behauptungen begegnen, ohne selbst in die Falle der Polemik zu tappen? Die Antwort liegt in einer fundierten, faktenbasierten Argumentation und einer kritischen Herangehensweise an Informationen.
Zunächst einmal ist es essenziell, die Quellen der Informationen zu hinterfragen. Frage Dich immer: „Woher kommt diese Information?“ und „Wie glaubwürdig ist die Quelle?“ Oft sind es unbekannte Blogs oder Plattformen, die sensationelle, aber nicht belegbare Behauptungen verbreiten. Indem Du auf verlässliche und etablierte Quellen zurückgreifst, wie wissenschaftliche Studien, offizielle Statistiken oder Berichte von renommierten Institutionen, stärkst Du Deine eigene Argumentation und machst es schwer für Fake News, sich durchzusetzen.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Verwendung von Faktenchecks. Es gibt mittlerweile zahlreiche unabhängige Organisationen und Plattformen, die sich darauf spezialisiert haben, Fake News zu entlarven. Nutze diese Ressourcen, um Behauptungen zu überprüfen und Dir selbst ein fundiertes Bild zu machen. Beispielsweise kannst Du in einer Diskussion über Verschwörungstheorien zu politischen Ereignissen darauf hinweisen, dass mehrere Faktencheck-Portale diese Theorien widerlegt haben – so wird Deine Argumentation nicht nur sachlich, sondern auch glaubwürdig.
Ein gutes Beispiel aus der Praxis: Angenommen, in einem Online-Forum wird behauptet, dass ein bestimmtes Ereignis nie stattgefunden hat. Anstatt sofort in hitzige Debatten zu verfallen, könntest Du sagen: „Hast Du schon mal bei unabhängigen Faktencheck-Seiten nachgeschaut? Dort wird das Thema umfassend beleuchtet.“ So regst Du Deinen Gegenüber dazu an, selbst zu recherchieren, und bringst die Diskussion in eine konstruktive Richtung.
Auch der Umgang mit emotional aufgeladenen Behauptungen spielt eine große Rolle. Verschwörungstheorien basieren oft darauf, Angst und Misstrauen zu schüren. Hier hilft es, ruhig und sachlich zu bleiben und auf die tatsächlichen Fakten hinzuweisen. Eine Frage, die Du Dir und Deinem Diskussionspartner stellen kannst, lautet: „Welche konkreten Belege gibt es für diese Theorie?“ Indem Du die Diskussion auf diese Weise strukturierst, zeigst Du, dass unbelegte Behauptungen keinen Platz in einem rationalen Dialog haben.
Darüber hinaus ist es wichtig, nicht in einen reinen Faktenkrieg zu verfallen. Zwar sind Fakten zentral, doch solltest Du auch darauf achten, den emotionalen Aspekt nicht völlig zu ignorieren. Viele Menschen fühlen sich von Verschwörungstheorien angezogen, weil sie sich dadurch verstanden und nicht allein gelassen fühlen. Zeige Empathie: Erkläre, warum es verständlich ist, dass manche Menschen nach einfachen Antworten in einer komplexen Welt suchen – aber mache gleichzeitig deutlich, dass fundierte Informationen der beste Weg sind, um Klarheit zu gewinnen.
Ein weiterer praktischer Tipp: Nutze Analogien, um komplexe Zusammenhänge zu erklären. Du könntest zum Beispiel sagen: „Stell Dir vor, jeder würde in einem Orchester nur seine eigene Melodie spielen, ohne aufeinander zu hören – das wäre ein einziges Durcheinander. So ähnlich ist es, wenn wir uns auf unbelegte Theorien stützen, anstatt zusammen an einem harmonischen Gesamtbild zu arbeiten.“ Solche Vergleiche machen es leichter, abstrakte Konzepte greifbar zu machen und Deine Argumentation zu verankern.
Abschließend bleibt zu sagen, dass der Schlüssel im Umgang mit Fake News und Verschwörungstheorien in einer Kombination aus kritischem Denken, der Überprüfung von Quellen und einer empathischen Kommunikation liegt. Wenn Du diese Strategien verfolgst, wirst Du nicht nur selbst besser informiert sein, sondern auch in der Lage sein, andere von der Wichtigkeit fundierter Informationen zu überzeugen.
Fakten, Emotionen, Haltung: Die richtige Balance finden
Hast Du Dich schon einmal gefragt, wie Du in hitzigen Diskussionen sowohl sachlich als auch authentisch bleiben kannst? Es ist ein schmaler Grat, den wir oft gehen müssen: Zu viele Fakten können kalt und unnahbar wirken, während eine rein emotionale Argumentation als unsachlich abgetan wird. Die Kunst liegt darin, eine ausgewogene Mischung aus Fakten, Emotionen und einer klaren persönlichen Haltung zu finden.
Fakten sind das Fundament jeder guten Diskussion. Sie geben Deiner Argumentation Stabilität und machen sie nachvollziehbar. Aber Fakten allein reichen oft nicht aus, um das Herz Deines Gegenübers zu erreichen. Hier kommen Emotionen ins Spiel. Emotionen verbinden, berühren und können komplexe Informationen in einprägsame Geschichten verwandeln. Wenn Du beispielsweise in einer Diskussion über soziale Gerechtigkeit sprichst, kannst Du konkrete Beispiele aus dem Leben nutzen, um die Bedeutung Deiner Argumente zu unterstreichen. Vielleicht erzählst Du von einer persönlichen Begegnung oder schilderst, wie bestimmte Maßnahmen das Leben von Menschen verbessert haben. So schaffst Du einen Bezug zur Realität, der im Gedächtnis bleibt.
Doch Vorsicht: Zu viel Emotion kann auch den Eindruck von Parteilichkeit erwecken und Deine Argumentation schwächen. Der Trick besteht darin, Emotionen gezielt und dosiert einzusetzen – wie bei einem guten Gewürz, das das Gericht erst richtig abrundet, ohne den natürlichen Geschmack zu überdecken. Stelle Dir vor, Du erzählst eine Geschichte: Beginne mit den harten Fakten und streue dann emotionale Details ein, die den Leser fesseln, aber nie die objektive Basis Deiner Argumentation untergraben.
Die persönliche Haltung darf dabei nicht fehlen. Gerade in Diskussionen, in denen kontroverse Themen wie Populismus oder Fake News auf dem Spiel stehen, ist es wichtig, authentisch zu bleiben und klar zu signalisieren, wofür Du stehst. Deine Haltung zeigt sich in Deiner Wortwahl, Deinem Tonfall und auch in der Art und Weise, wie Du auf Einwände reagierst. Eine klare Haltung hilft nicht nur Dir, sondern auch Deinem Gegenüber zu verstehen, dass es hier um mehr geht als um eine reine Faktenwette – es geht um Werte und Überzeugungen, die Dein Handeln leiten.
Ein praktischer Ansatzpunkt ist es, immer wieder nachzufragen: „Wie siehst Du das eigentlich?“ oder „Was bedeutet diese Information für Dich persönlich?“ So lädst Du Deinen Diskussionspartner ein, ebenfalls seine emotionale und persönliche Perspektive einzubringen, anstatt in einem reinen Faktenkampf zu verharren. Dadurch entsteht ein Dialog, in dem beide Seiten ihre Sichtweisen darlegen können und am Ende alle Beteiligten ein besseres Verständnis für das Thema entwickeln.
Ein weiterer Tipp: Nutze rhetorische Mittel wie Metaphern und Analogien, um komplexe Sachverhalte greifbar zu machen. Stell Dir vor, Du erklärst die Bedeutung einer ausgewogenen Diskussion als das Stimmen eines Orchesters – jeder Musiker (Fakt) muss im richtigen Maß laut (Emotion) und mit der passenden Haltung spielen, damit am Ende ein harmonisches Konzert entsteht. Solche Bilder bleiben im Gedächtnis und helfen, Deine Argumente nachhaltig zu verankern.
Zum Schluss ist es wichtig, dass Du Deine Balance regelmäßig überprüfst. Frage Dich selbst: „Bin ich noch sachlich oder lasse ich mich zu sehr von Emotionen leiten?“ Eine regelmäßige Selbstreflexion und das Einholen von Feedback können Dir helfen, Deine Kommunikation stetig zu verbessern. So bleibst Du nicht nur authentisch, sondern auch überzeugend – egal wie hitzig die Diskussion wird.
Wie man Diskussionen beendet, wenn sie destruktiv werden
Nicht jede Diskussion führt zu einem fruchtbaren Ergebnis – manchmal geraten Gespräche in eine Spirale aus Beschimpfungen, Schuldzuweisungen und destruktiven Vorwürfen. Gerade in solchen Situationen ist es wichtig, zu wissen, wie man einen klaren Schlussstrich ziehen kann, ohne dabei den eigenen Standpunkt zu verraten.
Zunächst einmal ist es wichtig, Anzeichen für eine destruktive Diskussion frühzeitig zu erkennen. Wenn Du merkst, dass das Gespräch von sachlichen Argumenten in persönliche Angriffe abdriftet oder wenn Dein Gegenüber nur noch darauf aus ist, Dich zu provozieren, ist es Zeit, die Diskussion zu beenden. Eine effektive Methode ist es, ruhig zu signalisieren, dass das aktuelle Gespräch nicht mehr zielführend ist. Du könntest sagen: „Ich merke, dass wir uns gerade sehr emotional bewegen und ich glaube, dass wir im Moment nicht mehr konstruktiv weiterdiskutieren können.“ Diese Formulierung zeigt, dass Du die Situation ernst nimmst, ohne dabei den anderen direkt anzugreifen.
Eine weitere Strategie ist es, das Gespräch auf eine spätere, ruhigere Gelegenheit zu verschieben. Du kannst vorschlagen: „Lass uns das Thema zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal in Ruhe besprechen, wenn wir beide etwas runtergekommen sind.“ Oft hilft schon diese kleine Pause, um die Gemüter zu beruhigen und eine neue, sachlichere Basis zu schaffen.
Wenn Dein Gegenüber jedoch weiterhin destruktiv agiert und keine Bereitschaft zu einem konstruktiven Dialog zeigt, ist es völlig legitim, die Diskussion abzubrechen. Dabei ist es wichtig, Deine eigenen Grenzen zu wahren. Ein einfacher Satz wie: „Ich möchte heute nicht weiter in diese Richtung diskutieren“ signalisiert klar, dass Du Dich nicht weiter in eine destruktive Auseinandersetzung hineinziehen lässt. Es geht hier nicht darum, den anderen zu bestrafen, sondern darum, Deine eigene mentale und emotionale Gesundheit zu schützen.
Ein praktisches Beispiel aus dem Alltag: Stell Dir vor, Du bist in einem Online-Forum oder auf Social Media und die Diskussion wird zunehmend persönlich und beleidigend. Anstatt weiter auf jeden provokativen Kommentar zu reagieren, kannst Du kurz und sachlich erklären, dass Du Dich nicht auf dieses Niveau herabbegeben möchtest, und Dich dann zurückziehen. Manchmal ist es besser, den virtuellen Raum zu verlassen, als sich in endlosen Diskussionen zu verlieren, die mehr Stress als Nutzen bringen.
Nicht zuletzt solltest Du auch an Dich selbst denken. Nach einer hitzigen Diskussion ist es sinnvoll, einen Moment der Ruhe einzulegen und die eigene Perspektive zu reflektieren. Vielleicht hilft es, einen Spaziergang zu machen, Musik zu hören oder mit einem Freund über das Erlebte zu sprechen. So kannst Du den emotionalen Druck abbauen und mit einem klareren Kopf wieder in den Alltag starten.
Abschließend sei gesagt, dass das Beenden einer destruktiven Diskussion kein Zeichen von Schwäche, sondern von Selbstschutz und Klarheit ist. Du setzt damit ein Zeichen dafür, dass Du Wert auf respektvolle und sachliche Auseinandersetzungen legst und Dich nicht auf manipulative Kommunikationsmuster einlässt.
Fazit
In diesem Artikel haben wir gemeinsam verschiedene rhetorische Techniken und Strategien beleuchtet, die Dir helfen, in Diskussionen souverän aufzutreten – egal, ob es um populistische Parolen, Whataboutism, Fake News oder destruktive Gesprächsverläufe geht. Mit fundierten Fakten, dem gezielten Einsatz von Emotionen und einer klaren persönlichen Haltung bist Du bestens gerüstet, um auch in hitzigen Debatten einen kühlen Kopf zu bewahren und Deine Position überzeugend darzulegen.
Denk daran: Es geht nicht darum, jede Diskussion zu gewinnen, sondern um den konstruktiven Austausch von Ideen und Perspektiven. Bleib authentisch, sei offen für neue Erkenntnisse und schütze Dich vor destruktiven Angriffen, indem Du klar Deine Grenzen setzt. So trägst Du nicht nur zu einem respektvolleren Diskurs bei, sondern stärkst auch Deine eigene Überzeugungskraft im Alltag.
Mit den hier vorgestellten Techniken kannst Du den Herausforderungen moderner Kommunikationskultur gelassen und informiert begegnen – und das ist ein Gewinn, der weit über die Diskussionen hinaus wirkt.
Egal, ob Du im Freundeskreis, auf Social Media oder im öffentlichen Diskurs mit diesen Herausforderungen konfrontiert wirst: Die richtigen rhetorischen Werkzeuge helfen Dir, Dich klar zu positionieren und gleichzeitig einen respektvollen Dialog zu fördern. Nutze die vorgestellten Tipps und Techniken als Deinen persönlichen Werkzeugkasten und mach Dich bereit, jede Diskussion – egal wie hitzig sie wird – mit Selbstvertrauen und Sachlichkeit zu meistern.